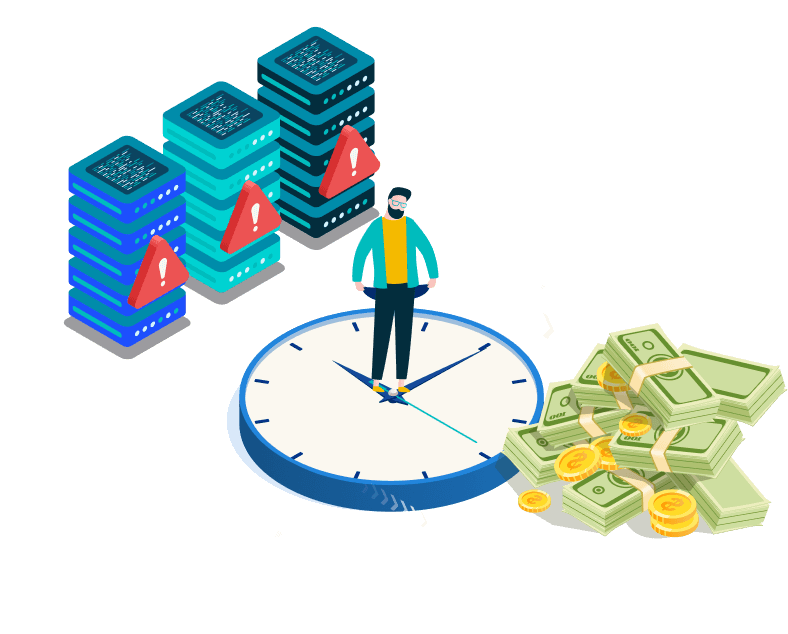Die moderne Wirtschaft ist extrem datenabhängig. Wer nicht ständig online ist, wird abgehängt, und Ausfallzeiten sind längst kein reines IT-Problem mehr. Sie betreffen das gesamte Unternehmen. Systeme sind immer stärker vernetzt und alle Geschäftsprozesse sind auf digitale Dienste angewiesen. Jede Störung der Kerninfrastruktur kann direkte, messbare Schäden verursachen.
Trotzdem unterschätzen viele Unternehmen immer noch, wie teuer selbst Ausfallzeiten von nur wenigen Minuten sein können.
Was sind Ausfallzeiten?
Der Begriff „Ausfallzeit“ bezeichnet jeden Zeitraum, für den ein System oder eine Anwendung nicht verfügbar ist oder nicht wie beabsichtigt funktioniert. Es gibt geplante Ausfallzeiten (z. B. Wartungsfenster) und ungeplante Ausfallzeiten (z. B. Hardwarefehler, Cyberangriffe, Softwareviren, Stromausfälle).
Geplante Ausfallzeiten lassen sich durch Vorausplanung und Kommunikation steuern. Ungeplante Ausfallzeiten kommen aus heiterem Himmel und können zu erheblichen Schäden führen.
Ausfallzeit = finanzieller Verlust
In erster Linie führt Ausfallzeit dazu, dass kein Umsatz erzielt wird. Bei Unternehmen, die auf Transaktionssysteme angewiesen sind – ob Onlineshops, Buchungsmaschinen oder Onlinebanking – bedeutet ein Ausfall, dass keine Einnahmen erzielt werden.
Beispiele:
- Ein globaler Zahlungsverarbeiter könnte bei einem 30-minütigen Ausfall zu Spitzenzeiten Millionen an Transaktionsvolumen verlieren – vom Vertrauen der Kunden ganz abgesehen.
- Gehen die Kassensysteme einer Einzelhandelskette auch nur kurz offline, kann dies zu Umsatzverlusten, Bestandsabweichungen und langen Schlangen an den Kassen führen, sodass sich die Kunden genervt verabschieden.
Selbst wenn in Ihrem Unternehmen keine Transaktionen in Echtzeit abgewickelt werden, können Ausfallzeiten Ihren Betrieb in Form von Produktionsverzögerungen oder Lieferkettenstörungen indirekt beeinträchtigen.
Das Uptime Institute fand heraus, dass ungeplante Ausfallzeiten von Anwendungen Unternehmen über 100.000 Dollar pro Zwischenfall kosteten – manche Ausfälle brachten es sogar auf über 1 Million Dollar, abhängig von Schweregrad und Dauer.
Betriebsstörungen und Produktivitätsverluste
Wenn Systeme ausfallen, können Menschen nicht arbeiten. Geschäftsprozesse, die auf den Echtzeitzugriff auf Anwendungen und Daten angewiesen sind, können nicht ausgeführt werden. Teams und Abteilungen müssen untätig ausharren, bis die Systeme wieder online sind.
- Software-Ingenieure haben keinen Zugriff auf Codespeicher und können nicht an ihren Pipelines arbeiten. So verzögern sich Neuentwicklungen und Bereitstellungen.
- Vertriebsteams verlieren den Zugriff auf CRMs, wodurch ihnen Opportunities und Follow-ups entgehen, die sich nicht ohne Weiteres aufholen lassen.
- Support-Teams können die Datensätze der Kunden und Ticketverläufe nicht aufrufen. Das frustriert die Nutzer und beeinträchtigt die Servicequalität.
- Produktionssysteme stoppen, weil die Prozessleitsysteme nicht funktionieren. Die Produktionsabläufe werden gestört, die Betriebskosten steigen.
Solche Produktivitätseinbußen schlagen Wellen durch das gesamte Unternehmen. Teams greifen entweder auf ineffiziente manuelle Umleitungen zurück oder stellen die Arbeit komplett ein. So werden Fälligkeitstermine überschritten, Projektzeiträume gesprengt und die Motivation ausgebremst. Selbst kurze Ausfälle können überdimensional große nachgelagerte Auswirkungen haben, vor allem in schnell getakteten oder stark automatisierten Umgebungen.
Versteckte Kosten: Markenimage, Vertrauen und Moral
Kunden erwarten Verfügbarkeit. Schon ein einziger Ausfall kann ihre Wahrnehmung drastisch verändern, vor allem, wenn Nutzer in Echtzeit in Social Media davon berichten.
- SaaS-Unternehmen riskieren, dass Kunden abwandern, wenn B2B-Kunden das Vertrauen in die Stabilität der Plattform verlieren.
- Gesundheitsorganisationen drohen Sicherheitsprobleme und aufsichtsrechtliche Strafen, wenn Systeme mit Patienten- oder Diagnosedaten unvermittelt offline gehen.
- Mitarbeiter sind frustriert, Support-Teams überlastet und die Moral leidet mit jeder Minute, die die Behebung des Zwischenfalls dauert.
Ein einziger Ausfall kann einen ganzen Rattenschwanz an negativen Auswirkungen für die Reputation nach sich ziehen, die weit länger anhalten als der Zwischenfall selbst.
Compliance- und Rechtsfolgen
Ausfälle können zu Verletzungen von Branchenvorschriften (z. B. HIPAA, DSGVO, NIS2, PCI-DSS) führen, wenn sensible Daten nicht länger durch Systeme geschützt sind oder nicht abgerufen werden können. Eine solche Situation kann Prüfungen, Gerichtsverfahren und drastische Bußgelder nach sich ziehen.
Beispiel: Ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das aufgrund eines Systemausfalls vorgeschriebene Meldungen nicht vornehmen kann, verstößt damit gegen gesetzliche Anforderungen. Neben der Rufschädigung drohen möglicherweise auch noch Bußgelder.
Was fällt eigentlich aus? Die Realität der Infrastruktur
Die meisten Ausfallzeiten entstehen nicht durch Naturkatastrophen oder raffinierte Cyberangriffe. Viel häufiger ist es die grundlegende Infrastruktur, die ausfällt, falsch konfiguriert ist oder ohne ausreichend Redundanz geplant wurde. Solche Probleme bauen sich still und leise auf und kommen erst dann an die Oberfläche, wenn es zu spät ist. Häufige Gründe:
- Single-points-of-failure in Speichersystemen oder Netzwerkpfaden
- Manuelle Failover-Prozesse, die langsam und fehleranfällig oder gar nicht vorhanden sind
- Alternde Hardware, die moderne hochverfügbare Konfigurationen nicht mehr unterstützt
- Fehlende Echtzeit-Replikation zwischen kritischen Speicherservern und damit verbunden Datenverluste oder Inkonsistenzen
- Wiederherstellungsverfahren, die eine manuelle Intervention oder den vollständigen Neustart der Systeme erfordern und so die Ausfallzeit von Minuten auf Stunden verlängern
In vielen Fällen passieren solche Ausfälle nicht isoliert; sie laufen lawinenartig ab. Eine einzige ausgefallene Komponente verlangsamt alle Abläufe, löst Engpässe und I/O-Zeitfehler aus, bis am Ende die gesamte Anwendung abstürzt. Am häufigsten gehen Ausfallzeiten auf Designfehler zurück und nicht auf unglückliche Umstände.
Die Speicherebene: die am häufigsten übersehene Ursache von Ausfällen
Wenn es um Verfügbarkeit geht, wird Anwendungen, Netzwerken und Rechenkapazität die größte Aufmerksamkeit geschenkt. In der Realität ist es jedoch häufig der Speicher, der für ungeplante Ausfälle oder längere Wiederherstellungszeiten sorgt – nicht etwa, weil er selbst anfällig ist, sondern weil er bei der Architektur nicht genügend beachtet wurde; Stichworte: Verfügbarkeit und Fehlertoleranz.
In vielen Umgebungen wird das Speichersystem zum Single-point-of-failure, speziell in Systemkonfigurationen mit Direct Attached Storage (DAS), traditionellen SAN-Arrays mit begrenzter Controller-Redundanz oder isolierten Systemen ohne Replikation. Ein Festplattenausfall mag zunächst nicht katastrophal erscheinen, doch in Systemen ohne Synchronen Spiegel oder automatisches Failover können selbst kleinere Störungen zu einer Kaskade von gesperrten Datenträgern, unterbrochenen Schreibvorgängen oder Abstürzen im kompletten Stack führen.
Die Resilienz des I/O-Pfads ist genauso kritisch. Ist das Multipathing inkorrekt konfiguriert oder wird der Speicher-Controller durch die Failover-Last zum Engpass, leidet die Reaktion der Anwendungen, selbst wenn der Speicher technisch nicht offline ist. Diese Art von „Greyout“, bei der die Verschlechterung der Performance wie ein Totallausfall wirkt, ist bei Transaktionen oder latenzempfindlichen Workloads besonders gefährlich.
Der Speicher spielt auch für die Recovery Time Objectives (RTO) eine wichtige Rolle. Snapshots, Replikationsverzögerungen oder uneinheitlich bereitgestellte Datenträger können die für die Wiederherstellung benötigte Zeit unnötig in die Länge ziehen. Und wenn es Speicherplattformen an granularer Transparenz oder zentraler Orchestrierung mangelt, verlängert dies die Reaktionszeit bei Zwischenfällen und zwingt Teams, blind auf Fehlersuche zu gehen.
In modernen Umgebungen, speziell in solchen, in denen Virtualisierung, Containerisierung und verteilte Anwendungen dominieren, muss die Speicherinfrastruktur störungsfreies Skalieren, Live-Updates, schnelles Failover und richtliniengesteuerte Automatisierung unterstützen. Ohne diese Fähigkeiten ist selbst ein gut geplanter Rechen- oder Anwendungsstack anfällig.

Wie DataCore Ihnen hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden
Ausfallzeiten sind häufig auf Lücken in der Speicherebene zurückzuführen. Durch mangelnde Redundanz, begrenzte Failover-Automatisierung oder Performance-Engpässe kann sich eine kleine Störung zu einem ausgewachsenen Systemausfall entwickeln. DataCore mindert diese Risiken durch die Unterstützung von serverübergreifendem synchronem Spiegeln und kontinuierlichen I/O-Operationen auch beim Ausfall eines Servers oder Pfads. DataCore ermöglicht außerdem unterbrechungsfreie Wartungen und Upgrades, sodass auf geplante Wartungszeitfenster – die die Verfügbarkeit natürlich beeinträchtigen – verzichtet werden kann. Eingebaute Failover-Logik und Mechanismen für die schnelle Wiederherstellung verringern die Notwendigkeit manueller Interventionen, sodass Ihre Teams die Systeme im Idealfall innerhalb von Sekunden (und nicht Stunden) wieder zum Laufen bringen können.
Um die Hochverfügbarkeit in unterschiedlichsten Umgebungen – vom Großunternehmen bis zu abgelegenen oder verteilten Standorten – zu gewährleisten, bietet DataCore maßgeschneiderte Lösungen an:
- SANsymphony ist ideal für Kernrechenzentren, die für ihre missionskritischen Arbeitslasten auf hohe Performance, große Volumina und kontinuierliche Verfügbarkeit angewiesen sind.
- StarWind (jetzt Teil von DataCore) bietet eine kompakte, widerstandsfähige HCI-Lösung für Edge-, ROBO- und dezentrale IT-Umgebungen, in denen es auf Einfachheit, geringen Platzbedarf und hohe Verfügbarkeit ankommt.
Um zu erfahren, wie DataCore Ihnen helfen kann, Ausfallzeiten zu vermeiden und Ihre Infrastruktur zu stärken, kontaktieren Sie uns, um ein Beratungsgespräch oder eine Demo zu vereinbaren.